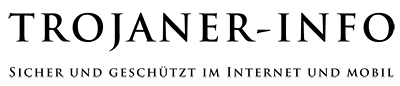Wer soll das bezahlen?
Auf golem.de wurde dieser Frage nachgegangen. Nach Verbraucher- und Datenschützern haben inzwischen auch die Stromversorger ihre Bedenken an den Regierungsplänen geäußert. Während die Verbraucherschützer die möglichen Kosten für den Einbau vernetzter Stromzähler, sogenannter intelligenter Messsysteme, für zu hoch halten, befürchten die sogenannten Verteilnetzbetreiber (VNB) wie Stadtwerke und Energiekonzerne, dass ihre Kosten für Einbau und Betrieb der Geräte nicht gedeckt werden.
Die Bundesregierung will mit ihrem Beschluss, verbrauchsabhängige Preisobergrenzen für den Einbau intelligenter Messsysteme zu schaffen, die Ausgaben der Haushalte begrenzen. Diese liegen bei einem Jahresverbrauch unter 2.000 kWh bei 23 Euro im Jahr, bei einem Verbrauch zwischen 2.000 und 3.000 kWh bei 30 Euro im Jahr, bei einem Verbrauch zwischen 3.000 und 4.000 kWh bei 40 Euro und einem Verbrauch von 4.000 bis 6.000 kWh bei 60 Euro. Ab einem Jahresverbrauch von 6.000 kWh ist der Einbau der Messsysteme verpflichtend. Dabei dürfen laut Gesetzentwurf den Verbrauchern jährlich nicht mehr als 100 Euro für den Betrieb in Rechnung gestellt werden.
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) meldet Bedenken an
Der BDEW bezweifelt die angesetzten Obergrenzen und führt dabei die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsstudie „Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden Einsatz intelligenter Zähler“ an. Demnach sei auch der Umfang der Leistungen, die die Stromversorger erbringen müssten, im Vergleich zur Studie erhöht worden. Der BDEW betont daher in seiner Stellungnahme für den Bundestag:
"Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Preisobergrenzen für den Messstellenbetrieb decken dauerhaft nicht die beim Einbau und Betrieb intelligenter Messsysteme entstehenden Kosten."
Nach den Vorstellungen der Versorger würden die Preisobergrenzen noch einmal um 19 Prozent angehoben.
Daneben sollen auch die Verbraucher für die Kosten aufkommen, obwohl der Nutzen der vernetzten Zähler für sie sehr begrenzt ist. Dazu heißt es vom BDEW:
"Die Kosten für umfangreiche Umbaumaßnahmen des Zählerplatzes in den Kundenanlagen dürfen nicht zulasten der Messstellenbetreiber gehen"
Neue Stromzähler lassen Kassen klingeln
Allerdings wurde durch die Regierung den Messstellenbetreibern die Möglichkeit gegeben, auch Haushalte an ein intelligentes Messsystem anzuschließen, die weniger als 6.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Was für 38,5 Millionen der 45 Millionen Messstellen in Deutschland gilt. Diese Option könnte vor allem in Mehrfamilienhäusern genutzt werden, bei denen an ein einzelnes Smart Meter Gateway, das die Kommunikation mit dem Netzbetreiber ermöglicht, bis zu 256 elektronische Stromzähler angeschlossen werden können. Dabei kann der Stromversorger von jedem Verbraucher die festgelegten Höchstpreise verlangen, obwohl die Kosten schon von einem Verbraucher mit 6.000 Kilowattstunden getragen würden.
Ein Umstand, der nach Widerspruch schreit, der aber wahrscheinlich nicht von der großen Koalition im Bundestag eingeräumt werden wird. Dagegen wurde deutlich, dass eine Anhebung der Obergrenzen um die 19 Prozent für die Mehrwertsteuer nicht ausgeschlossen ist.
Verbraucher bleiben auf der Strecke
Dazu kommentierte der Grünen-Politiker Oliver Krischer:
"Sie können den Verbrauchern einfach keinen Benefit anbieten, weil es überhaupt keine lastabhängigen Tarife gibt, von denen die Verbraucher einen Nutzen hätten."
"Wenn Sie eine Zwangsbeglückung vornehmen, können Sie nicht gleichzeitig auch noch eine Ungleichbehandlung machen"
Noch ist der Umfang der Versorgung für Kleinverbraucher mit teuren Messsystemen unklar. Nach dem Willen des BDEW sollen kleine Privathaushalte möglichst wenig belastet werden.
Die Aggregierung der Daten
Der Gesetzentwurf sieht in den Paragrafen 66 und 67 des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) folgende Aufgabenverteilung zwischen den vier großen Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) und den Stromversorgern vor. Demnach sollen die ÜNB wie Tennet, Amprion, 50Hertz und TransnetBW die Daten der intelligenten Messsysteme "vorverdichten", während die Verteilnetzbetreiber wie gehabt die Daten der herkömmlichen Zähler (Ferraris-Zähler) und elektronischen Zähler aggregieren sollen. Ein Vorgehen, dass der BDW als umständlich kritisiert, da die einzelnen Beteiligten die aggregierten Daten hin- und herschicken. Zudem seien die kleinteiligen Daten der einzelnen Messstellen für die ÜNB von wenig Interesse und nicht so leicht zu plausibilisieren.
Hierzu heißt es aus Bundestagskreisen, dass die Vor-und Nachteile einer solchen Verlagerung vom Verteilnetzbetreiber zum Übertragungsnetzbetreiber nochmals zu überdenken sind. Die Weitergabe der Daten betrifft im Grunde nur Kunden mit einem Verbrauch von mehr als 10.000 Kilowattstunden im Jahr. In allen anderen Fällen soll der Stromverbrauch wie bisher nur einmal jährlich abgelesen werden - solange der Kunde nichts anderes wünscht.
Worin bestehen die Gefahren
Die neuen elektronischen Zähler sollen bei Haushalten, die über einem Verbrauch von 6000 Kilowattstunden liegen, zwingend eingebaut werden. Da kommen zusätzliche Kosten auf den Verbraucher zu. Daneben unterliegt der gesamte Stromverbrauch einer kompletten Überwachung. Die feinfühligen Zähler erkennen genau welches Fernsehprogramm gewählt wurde und wann welche Geräte genutzt wurden. Ein unendlicher Datenfundus für die Werbebranche oder auch Versicherungen. Wenn dann Haushaltsgeräte entsprechende Signale aussenden, entsteht ein weiteres Überwachungspotenzial für Verfassungsschutz und Kriminelle.